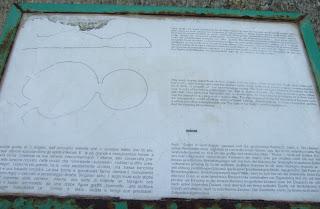Ausgangspunkt der Kolonisation war nicht das Mutterland, sondern das 60 km weiter im Osten an der sizilianischen Südküste gelegene Gela. Akragas wurde als Besonderheit gegenüber anderen großen sizilianischen Kolonistenstädten nicht direkt am Meer, sondern ein kleines Stück landeinwärts gegründet. Zwar in einer verhältnismäßig gut zu verteidigenden Lage, aber es wurde ein zusätzlicher Hafenort notwendig. Beim Hafen von Akragas ist bei mir nur etwas von verlandet/überbaut und keine Erwähnung einer archäologischen Sehenswürdigkeit hängen geblieben.
Beim heutigen Agrigento besteht ebenfalls so eine Aufteilung, wobei hier zwei Orte am Meer vorgelagert sind: Porto Empedocle und San Leone. Nach meinem Verständnis ist Porto Empedocle der Arbeitshafen - nach Baedecker ein Industrieort und Fährort zu den Pelagischen Inseln. Mir schien der Hafen in neuerer Zeit ausgebaut worden zu sein, und die Industrie mit größeren Brachflächen an den Kai-Anlagen hinterherzuhinken. San Leone ist eher der Vergnügungshafen mit Strandleben, da sind wir nur zu einem Espresso und nicht bis zur Strandevaluation vorgestoßen.

Auf Hinterlassenschaften der sikanischen Vorgängerkultur im Hinterland von Agrigent bin ich im vorherigen Blog-Eintrag über das ca. 20 km entfernte Sant'Angelo Muxaro eingegangen. Im letzten Abschnitt dieses Blog-Eintrags hatte ich weiterführende Links zum Vorgang der griechischen Kolonisation Siziliens angegeben.
Akragas war bis zur Zeit Pindars schon zur zweitmächtigsten Stadt auf Sizilien nach Syrakus angewachsen. Durch eine zusammen mit anderen Griechenstädten gewonnene Schlacht gegen eine von Karthagern geführte Koalition bei Himera um 480 v. Chr. erfolgte ein weiterer Zuwachs an Macht, Geld und Sklaven. Die folgenden Jahre gelten als die besten von Akragas - der dort geborene Philosoph Empedokles wird mit den Worten zitiert, die Einwohner der Stadt würden bauen als ob sie ewig lebten, und speisen, als ob sie morgen sterben würden.

Ein weiterer Karthager-Krieg beendete diese Hochblüte 406 v.Chr. Diese Eroberung soll zwar für die Bewohner verglichen mit der im selben Krieg ebenfalls eroberten großen Griechen-Stadt Selinunt glimpflich ausgegangen sein - je nach Quelle konnten sie alle in Richtung Syrakus vor den Angreifern aus der Stadt flüchten - die noch mehrfach notwendigen Neubesiedlungen der Stadt konnten aber nicht mehr an die alte Größe anknüpfen.
Vielfach in den folgenden Kriegen und unter den unterschiedlichen Herren ausgeplündert, blieben doch umfangreiche steinerne Hinterlassenschaften und machten Agrigent zum Anlaufpunkt vieler Sizilienreisenden. Bekannt sind diese Reisen vor allem durch die Italienische Reise 1787 von Johann Wolfgang Goethe und den Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802 von Johann Gottfried Seume geworden.

Bei Goethes Besuch hieß die Stadt noch Girgenti. Der Name wird auf das Kerkent oder Gergent („Ort der Riesen“) der Araber zurückgeführt, die die Stadt 827 eroberten. Die Römer nannten die Stadt Agrigentum. Umbenannt in Agrigento wurde sie erst 1927.
Den Startschuß für die Sizilien-Reisen gaben die Reisen von Johann Hermann von Riedesel 1767 und dem Schotten Patrick Brydone 1770. Die Reise von Riedesel wurde 1771 veröffentlicht, die von Brydone 1774 ins Deutsche übersetzt. Die folgenden Reisenden bauten auf deren Beschreibungen auf, so daß sich eine Standard-Tour unter Einschluß der Tempel von Agrigent herausbildete. Goethe soll sich bei seiner Reiseroute streng an Riedesel gehalten haben.

Riedesel ist mehr als Archäologe und Kunsthistoriker und weniger zu seinem Vergnügen gereist. Er gilt aus Ausgesandter Johann Joachim Winckelmanns, Winckelmann wiederum als Wegbereiter der klassischen Archäologie. Die Reise durch Sicilien und Großgriechenland von Johann Hermann von Riedesel ist in Form von Sendschreiben „seinem Freunde Winkelmann zugeeignet“ verfasst.
Neben der wissenschaftlichen muß die politische Dimension erwähnt werden: Griechenland war noch unter der Herrschaft des osmanischen Reichs. Erst 1821–1829 fand der griechische Befreiungskampf statt. In diesem Umfeld gab es den Philhellenismus, bei dem München und der bayerische König Ludwig I eine besondere Rolle spielten. Ludwig I hat den griechischen Befreiungskampf finanziell unterstützt, sein Sohn wurde im neu geschaffenen Staat als Otto I der erste König. Und nach der Wikipedia soll sogar die Benennung von Bayern mit y statt mit i im Griechen-Faible von Ludwig I. begründet sein.

Ludwig I. besuchte als Kronprinz zweimal Sizilien, einmal mit dem Maler Johann Georg von Dillis und 1823/24 mit dem Architekten Leo von Klenze. Klenze soll der Erste gewesen sein, der dabei die Tempel von Agrigent „wissenschaftlich vermessen“ hatte. Dieses Studium der griechischen Bauwerke hat in der Folge zahlreiche weitere Architekten nach Sizilien geführt. Seine Skizzen nutzte Klenze auch als Vorlagen für Gemälde, eines vom Zeustempel von Agrigent soll er 1828 Goethe geschenkt haben. Im Internet bin ich beim Suchen nach Klenze auf diese Webseite gestoßen, wo man Kopien seiner Bilder bekommen kann. Derzeit werden dort zwei Agrigenter Motive angeboten.
Die Wikipedia nennt eine lange Liste von über Bayern hinaus bekannten klassizistischen Bauwerken, die von Ludwig I. beauftragt und von Klenze entworfen wurden, darunter auch die Münchner Glyptothek. Was von den Tempeln Agrigents in diese Bauten übernommen wurde? Keine Ahnung, dazu habe ich beim Surfen nichts gefunden, vielleicht gibt es eine architekturhistorische Ecke die sich damit näher befasst. Bekannt sehen für mich Laien im Klenze-Wikipedia-Artikel die Atlanten seiner „Neuen Eremitage“ in Sankt Petersburg aus, die erinnern mich an die 7,65 m hohen Atlanten (oder Telamone, Giganten) des Agrigenter Zeus-Tempels.

Bei der Vasensammlung Panitteri kann hingegen zumindest der Verkäufer klar Agrigent zugeordnet werden. Sie wurde durch Klenze im Auftrag von Ludwig I. erworben und bildete den Grundstock für die Münchner Sammlung griechischer Vasen mit Weltgeltung, die in den folgenden Jahren immer weiter ausgebaut wurde.
Nach diesen vielen Themenfeldern mit Querbezügen noch dieses zum Schluß: Ludwig I. war ja auch derjenige, der die Prinzessin Therese heiratete und damit das Münchner Oktoberfest begründete und später in viel reiferem Alter eine Affäre mit Lola Montez hatte. Lola Montez soll aus der berühmten Vasensammlung zwei Vasen erhalten haben, die erst hundert Jahre für echt gehalten wurden, mittlerweile aber als Fälschung gelten. Der Leiter der Staatlichen Antikensammlung und der Glyptothek Prof. Dr. Raimund Wünsche glaubt, daß Ludwig I. der Auftraggeber dieser Fälschungen gewesen ist und Lola Montez die Fälschung nicht bekannt war. Der Link zum Artikel von Raimund Wünsche funktioniert leider nicht mehr, nach dem Link vermute ich, daß der Artikel in der Ausgabe 2002_1 von Aviso erschienen ist.

Die Fotos in diesem Blog-Eintrag stammen vom Wochenmarkt am Freitagmorgen in Agrigent. Die nicht essbaren Angebote fand ich wegen den vielen Ständen mit sich wiederholenden Billigartikeln nicht so toll. Die Nahrungsmittel waren ok. Salat und Obst nahmen wir mit, an die auf einigen Karren angebotenen Fische trauten wir uns nicht, aber bei einem dick mit Rosmarin ausgelegten Brathähnchen haben wir zugeschlagen. Das kannten wir nicht, war aber sehr lecker und das Hähnchen hatte auch ein paar Wochen älter werden dürfen als das durchschnittliche Münchner Brathendl. In den letzten beiden Bildern ist mein Blick auf meinen ersten Tempel von Agrigent festgehalten, im zweiten Bild ist der Tempel herangezoomt.